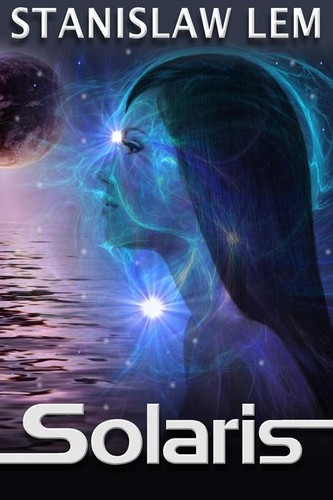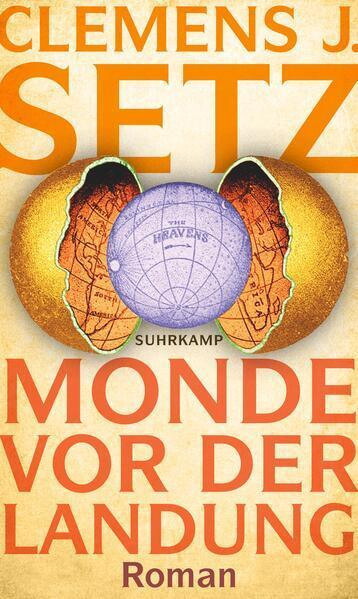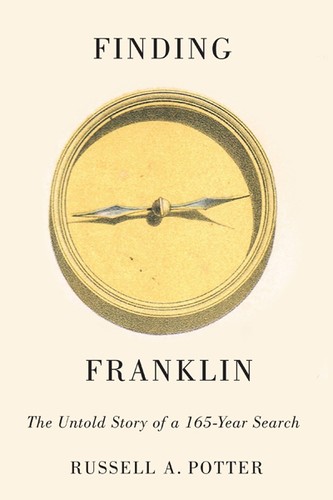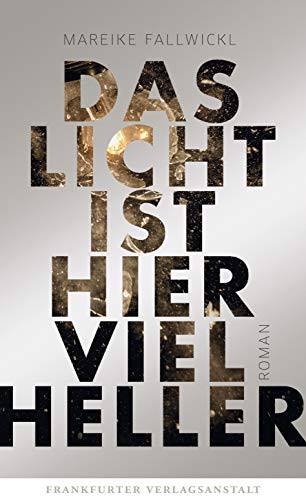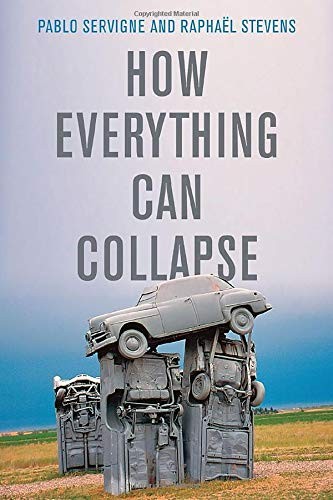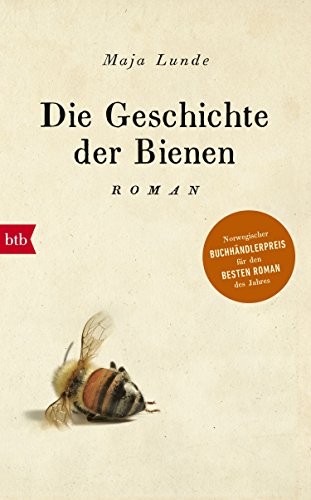(Spoiler am Ende der Rezension)
„Die Geschichte der Bienen“ ist in drei Handlungsstränge aufgeteilt. Jedes
Kapitel wird jeweils aus der Ich-Perspektive des englischen
Naturwissenschaftlers und Samenhändlers William im Jahr 1852, des amerikanischen
Imkers George im Jahr 2007 oder der chinesischen „Bestäuberin“ Tao im Jahr 2098
erzählt. Die Protagonisten verbindet dass ihr Schicksal eng mit dem der Bienen
verbunden ist.
William begegnen wir zunächst am Krankenbett. Körperlich scheint er gesund, aber
ein unbenanntes, psychisches Leiden fesselt ihn größtenteils ans Bett. Es ist
wohl eine tiefe Depression, die ihn lähmt. Wir erfahren schnell, dass die
Enttäuschung seines früheren Mentors Rahm ihn in eine tiefe Lebenskrise gestürzt
hat. Rahm verachtet William dafür, dass er die Insektenforschung aufgegeben hat,
um stattdessen mit seiner Frau Thilda eine Familie zu gründen. Den
Lebensunterhalt für seine acht Kinder – 7 Töchter und ein Sohn – verdient er als
Samenhändler. Diese Arbeit ist in den Augen Rahms wertlos. Erst ein Besuch
seines Sohns Edmunds am Krankenbett erweckt schließlich wieder seine alte
Leidenschaft für die Bienen. Durch die Entwicklung eines neuartigen Bienenstocks
will er sich den Respekt Rahms und Edmunds verdienen.
George ist Imker und sein Betrieb ist schon seit vielen Generationen im
Familienbesitz. Er wünscht sich, dass sein Sohn in den Betrieb einsteigt und ihn
schließlich einmal übernehmen wird. Doch Tom studiert an der Uni und
interessiert sich mehr für Bücher und Literatur. Es scheint, dass er lieber
einen anderen Weg einschlagen möchte. Überhaupt fällt es George schwer,
Verständnis für seinen Sohn und dessen Lebensentscheidungen aufzubringen. Ein
Generationenkonflikt bahnt sich an. Berichte aus dem Süden der USA, wo manchen
Imkerkollegen große Verluste unter ihren Bienenvölker bis hin zum Totalverlust
zu beklagen haben, machen ihm zusätzlich Sorgen.
Tao lebt mit ihrem Mann Kuan und ihrem dreijährigen Sohn Wei-Wen in China. Im
Jahr 2098 gibt es keine Bienen und andere bestäubende Insekten mehr. Auf das
Verschwinden der Bienen folgen Hungersnöte und Kriege. In China ist ein Großteil
der Bevölkerung nun damit beschäftigt, per Pinsel Blüten zu bestäuben, so auch
Tao und Kuan. Ihrem Sohn möchte Tao ersparen, dass er wie die anderen Kinder ab
acht Jahren, ebenfalls diese harte, körperliche Arbeit leisten muss. Sie fördert
ihn nach Kräften und versucht ihm schon früh Schreiben und Rechnen beizubringen.
Bei einem Ausflug an einem der seltenen freien Tage, läuft Wei-Wen aus Neugier
kurz weg. Als die Eltern ihn finden, ist er kaum noch ansprechbar. Die Lage
scheint ernst, und die Ärzte lassen die Eltern nicht zu Wei-Wen. Schließlich
wird er nach Peking verlegt. Tao macht sich auf die Suche nach ihrem Sohn.
Die Prämissen aller drei Handlungsstränge scheinen zunächst durchaus
interessant. Die Bienen und ihr Verschwinden stehen aber gar nicht so sehr im
Mittelpunkt, wie man vielleicht vermuten würde. Es geht hier eher um drei
Familiendramen. Besonders bei William und George stehen eher das Verhältnis zu
ihren Kindern im Vordergrund. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Leider
dreht sich meistens alles um die innere Gedankenwelt der Ich-Erzähler. Die
anderen Figuren bleiben überwiegend blass und eindimensional. Deren Motivation
ist kaum nachzuvollziehen. Die Protagonisten selbst erscheinen wenig einfühlsam.
Auch deren Handlungen sind oft schwer zu verstehen.
Überhaupt mangelt es dem Buch an sympathischen Identifikationsfiguren. Alle drei
Protagonisten gehen eher rücksichtslos mit ihren Partnern um. Alle drei haben
eine klare Vorstellung davon, wie ihre Söhne leben sollen, und fragen nicht nach
deren Wünschen. William erscheint zudem als frauenfeindlicher Widerling, der
seine Frau und seine Töchter geringschätzt. So verkennt er auch, dass seine
Tochter Charlotte viel motivierter und klüger ist als sein Sohn Edmund. George
ist nicht ganz so schlimm, aber besonders am Anfang kann man ihn sich gut mit
roter Make-America-Great-Again-Kappe vorstellen. Die Hauptfiguren lernen auch
nichts aus ihren Fehlern und entwickeln sich nicht weiter.
Die Handlung des Buchs ist sehr langatmig. Es gibt wenig Wendungen, und selbst
diese, kann man oft schon hundert Seiten vorher erahnen. Häufig werden Gedanken
und Gefühle der Protagonisten über mehrere Absätze oder gar Seiten ausgeführt,
ohne dass das notwendig oder interessant wäre. Ich habe hier immer mal wieder
einige Abschnitte nur kurz quergelesen. Der häufige Wechsel zwischen den
Perspektiven war für mich frustrierend. Ich wäre gerne länger bei einem der
Handlungsstränge geblieben, wurde aber ständig unterbrochen. Ohnehin ist die
Handlung erst nach der Hälfte des Buches einigermaßen in Fahrt gekommen.
Insgesamt hat es mich nicht gerade zum Buch hingezogen. Vielmehr musste ich mich
bewusst dafür entscheiden, dass ich dieses Buch zu Ende lesen will, um mir ein
abschließendes Urteil erlauben zu können.
Sprachlich fällt das Buch nicht negativ auf, aber auch auf keinen Fall positiv.
Es ist eher langweilig geschrieben. Die Sätze sind kurz und einfach. Die Dialoge
sind hölzern und wenig natürlich. Der Autorin gelingt es auch nicht den
Protagonisten eine jeweils eigene Stimme zu geben.
Als Science-Fiction-Roman ist der Tao-Handlungsstrang eher dürftig. Ich finde
das World-Building schwach. Viele Hintergründe erfährt man später als
„Exposition Dump“, wenn Tao darüber in Büchern liest. Die Geheimniskrämerei des
Regimes rund um Wei-Wen finde ich auch nicht nachvollziehbar. Überhaupt finde
ich die politische Situation in diesem dystopischen China nicht recht
überzeugend.
(ACHTUNG! AB HIER SPOILER!)
Dass Edmund dem Alkohol verfallen ist, fand ich ziemlich bald offensichtlich.
Dass William ihn erst vor der Kneipe betrunken sehen musste, um das zu
verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Dass auch Georges Bienenvölker
schließlich von der Colony Collapse Disorder betroffen sein würde, war sowieso
offensichtlich. Und dass Wei-Wen von einer Biene gestochen wurde und einen
allergischen Schock erlitten hat, war für mich offensichtlich. Somit fiel auch
diese Wendung für mich ziemlich flach. Warum die vermeintlich ausgestorbenen
Bienen plötzlich zurückkehren, wurde auch nicht ausreichend erklärt.
Aus der Rückschau finde ich vor allem den Handlungsstrang von William
überflüssig. Dass er ein Vorfahre von George ist, spielt eigentlich kaum eine
Rolle. Möglicherweise wollte die Autorin mit William die Überheblichkeit der
Menschen personifizieren, die sich die Bienen und die Natur zu Untertanen machen
wollen. Das wird kurz am Ende aufgegriffen, wenn Tao mit Hilfe von Toms Buch die
chinesische Anführerin (viel zu einfach) überzeugen kann, der Natur wieder Raum
zu geben und sich selbst zu überlassen. Dieses Thema ist aber wenig
ausgearbeitet, und es ist auch nicht klar, wovon die verbliebenen Menschen leben
sollen, wenn die Landwirtschaft quasi aufgegeben wird.
Auch Georges Handlungsstrang lässt mich etwas ratlos zurück. Am Ende scheint Tom
wieder in den Familienbetrieb einzusteigen. George hat sich aber gar nicht
weiterentwickelt, und es ist unklar, woher Toms Sinneswandel kommt. Soll die
Zerstörung der Baupläne Williams durch George symbolisieren, dass George sich
(zu spät) davon abkehrt, sich die Bienen Untertan machen zu wollen? Das wäre
aber nicht konsequent. Denn George wird im Kontrast zu seinem Kollegen Gareth
gar nicht als einer dargestellt, der konsequent Profit über alles andere setzt.
Ihn scheint ohnehin vielmehr die Liebe zu den Bienen anzutreiben. Außerdem
rekonstruieren George oder Tom die Baupläne später aus dem Gedächtnis. Wenn die
Zerstörung der Baupläne ein Symbol sein soll, dann wird das also wieder
verwässert.
(SPOILER ENDE)
Insgesamt kann ich dieses Buch auf keinen Fall weiterempfehlen. Es gibt so viele
bessere Bücher, die man eher lesen kann. Zwei Sterne gibt es nur, weil die
Prämisse immerhin interessant ist. Schade um das verschenkte Potential.